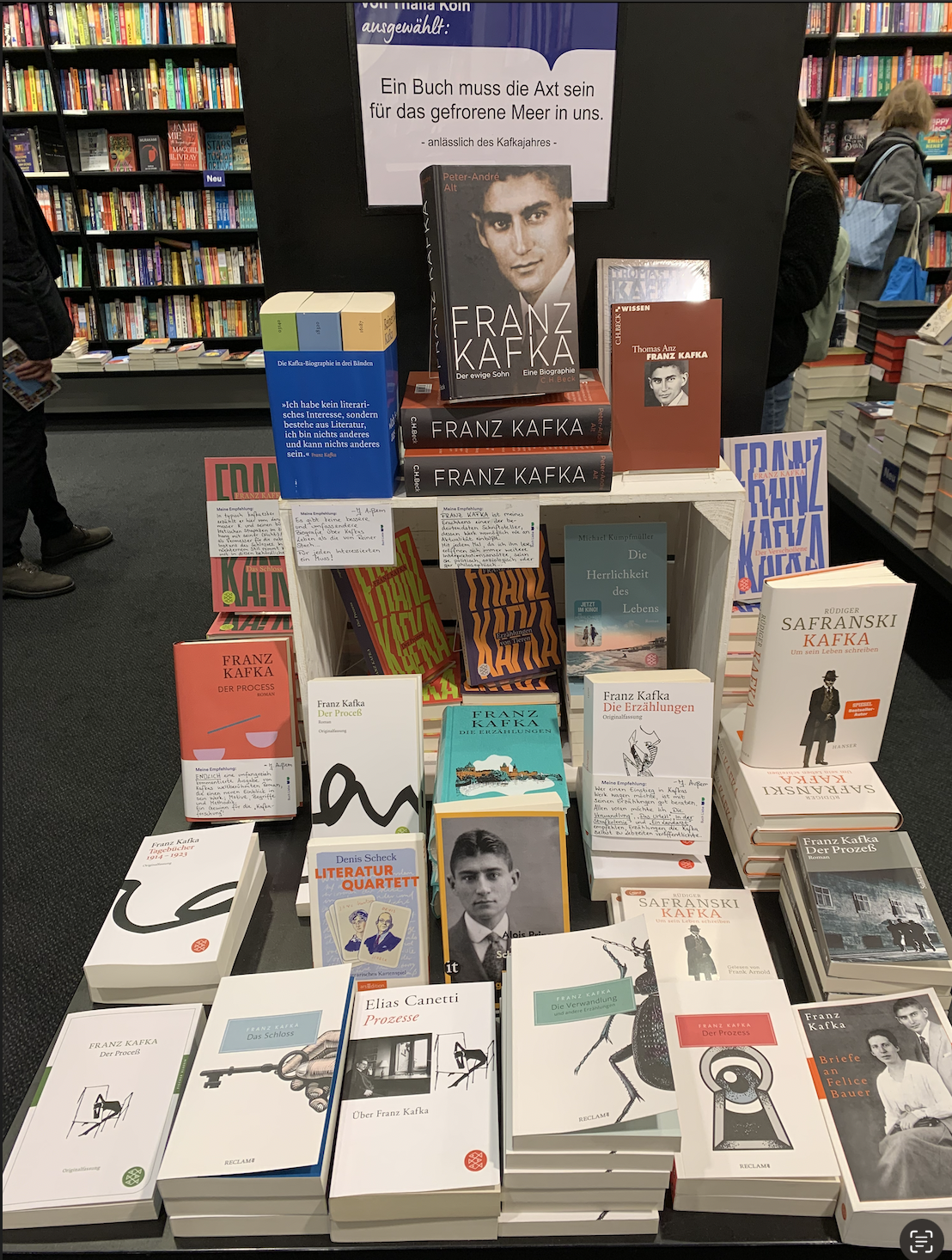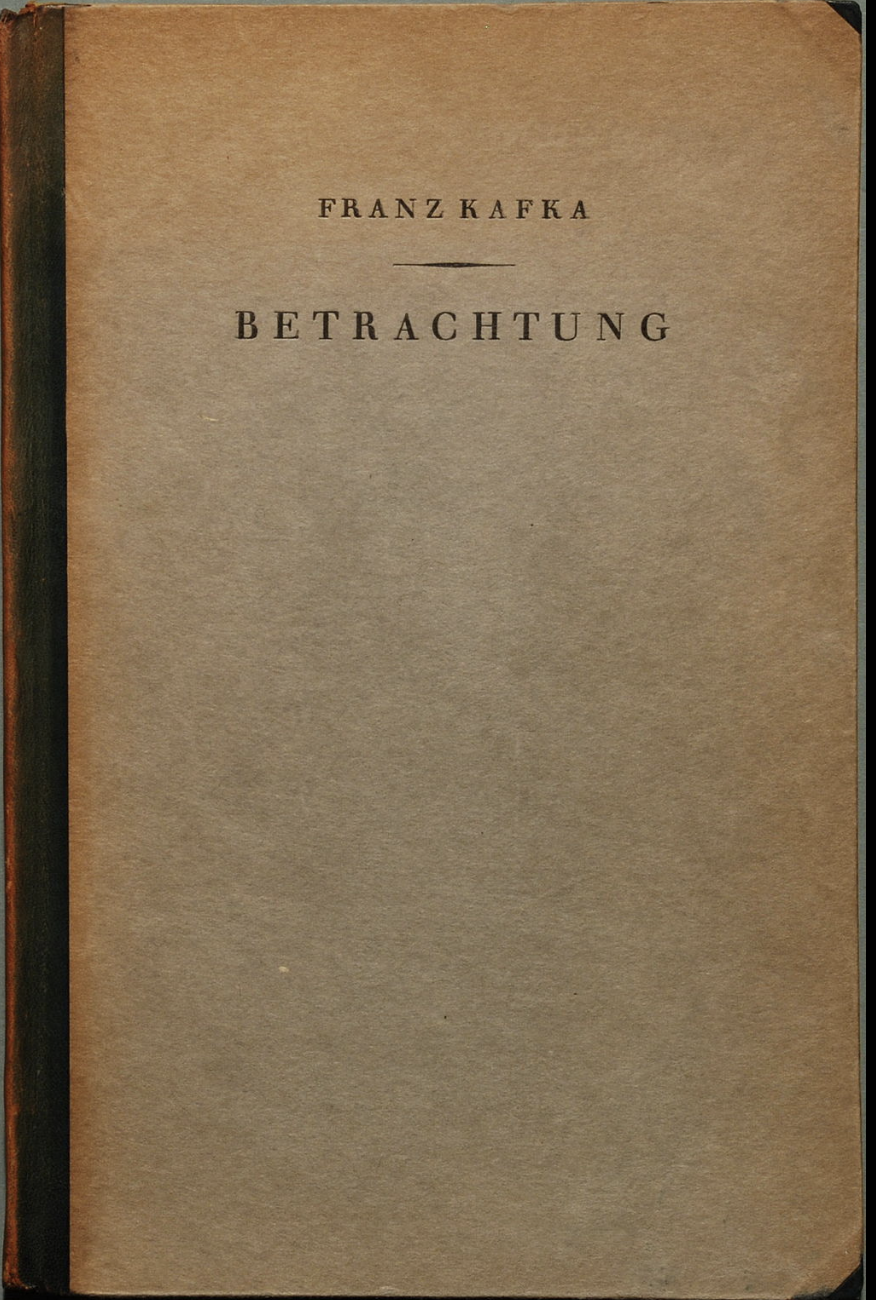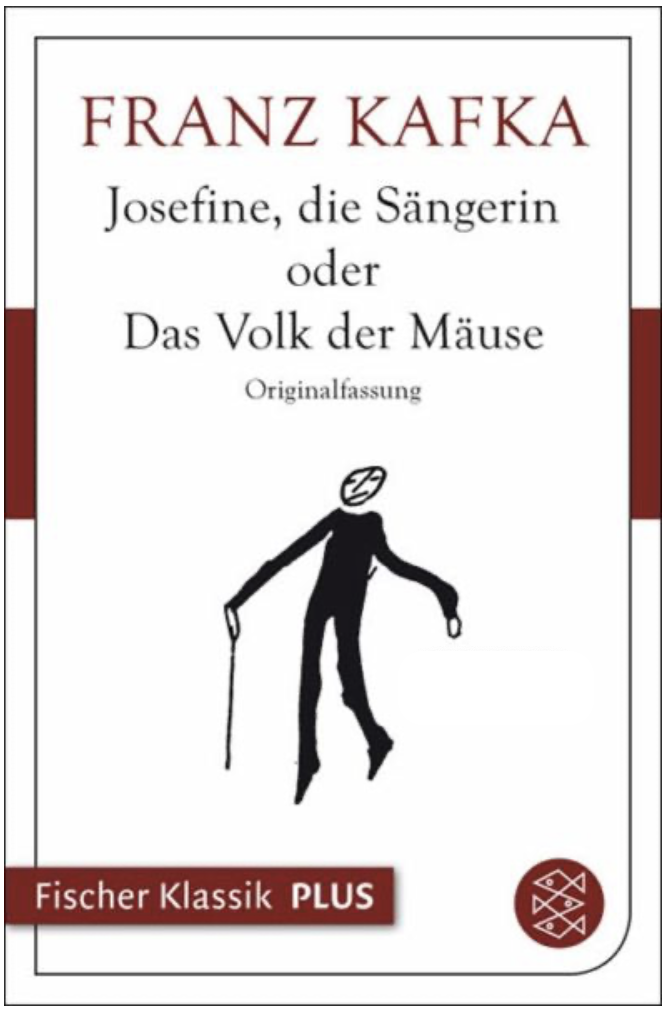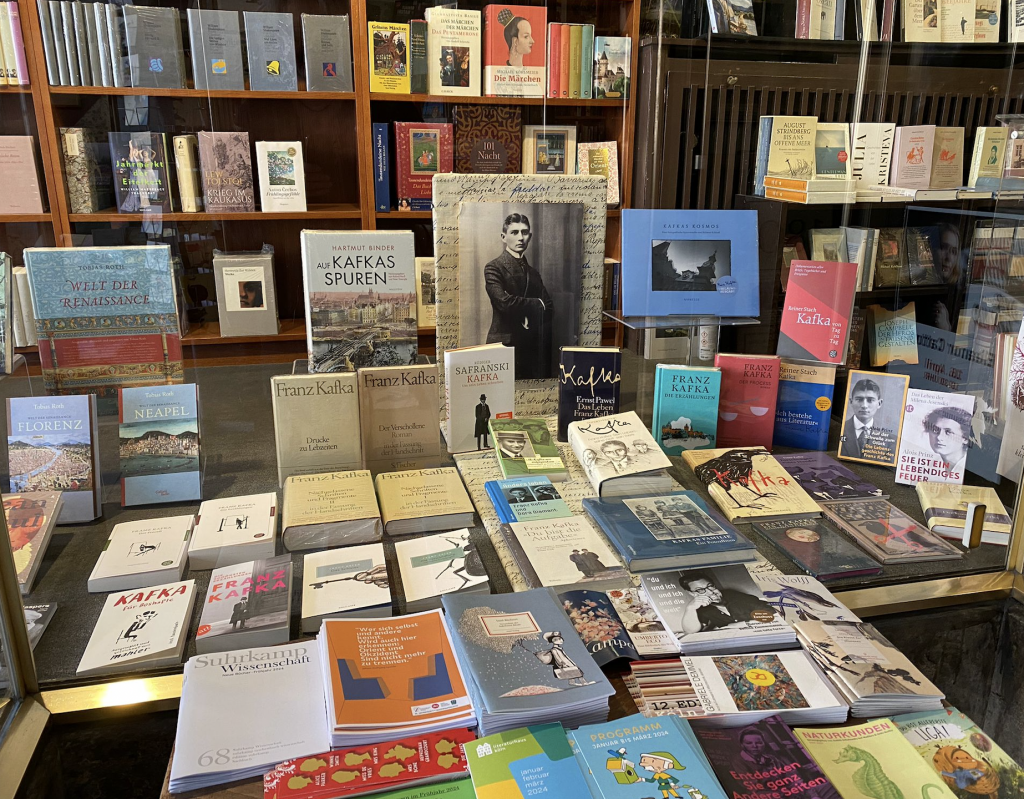Ein gesunder junger Mensch
Wer war Franz Kafka? Um diese Frage zu beantworten können wir nur zum einen auf die Aussagen des Menschen selbst – in seinen Werken, Briefen und Tagebüchern – und auf die Aussagen seiner Weggenossen zurückgreifen und finden so zwei widersprüchlich scheinende Bilder vor. Insbesondere im „Brief an den Vater“ zeichnet Kafka ein Bild von sich, das auch das allgemeine Bild in der belesenen Öffentlichkeit prägt. Kafka der Ängstliche, der Neurotische, der vom Vater Unterdrückte, der Schwache, der Kranke, der Verklemmte. Ein Bild, das möglicherweise falsch ist.
„Von irgendeinem Belastetsein durch zwanghafte düstere Jugendeindrücke, von Décadence oder Snobismus, die sich leicht als Auswege aus solcher Gedrückheit hätten anbieten können, von Zerknirschung der Seele war für den, der mit Kafka zusammentraf, nichts zu merken. Das, was in dem ‚Brief an den Vater‘ niedergelegt ist, schien nach außen hin nicht zu existieren – oder zeigte sich vielleicht nur andeutungsweise und nur bei sehr vertrautem Umgang. Ich lernte dieses Leid erst allmählich kennen und verstehen. Für den ersten Anschein war Kafka ein gesunder junger Mensch, allerdings merkwürdig still, beobachtend, zurückhaltend […] Ich habe es immer wieder erlebt, daß Verehrer Kafkas, die ihn nur aus seinen Büchern kennen, ein ganz falsche Bild von ihm haben. Sie glauben, er müsse auch im Umgang traurig, ja verzweifelt gewirkt haben. Das Gegenteil ist der Fall. Es wurde einem wohl in seiner Nähe.“
(Max Brod, Über Kafka, Frankfurt/Main 1958, Seite 41f.)
Auch wenn wir an zahlreichen Deutungen und Äußerungen von Max Brod über Franz Kafka heute zu recht zweifeln müssen – hierzu an späterer Stelle noch mehr – so ist Brods Bedenken gegenüber der Selbstschilderung Kafkas im „Brief an den Vater“ doch berechtigt.
Kafka selber hat an manchen Stellen betont, dass er sich literarisch überzeichnet und dass er zu Übertreibungen neige, so schrieb er an Felice Bauer am 13./14. Februar 1913:
„Siehst Du, ich verlange gar nicht, daß Du ins Schlimme übertreibst und die Übertreibung durchsichtig ist, so wie ich es – allerdings weniger aus Rücksicht auf Dich, als vielmehr infolge meiner Anlage – regelmäßig tue.“
(Franz Kafka, Briefe 1913 – 1914, Frankfurt/Main 1999)
Und in einem Brief an Grete Bloch vom 18./19. November 1913 fragt er:
„Die Lust, Schmerzliches möglichst zu verstärken, haben Sie nicht? Es scheint mir für instinktschwache Menschen oft die einzige Möglichkeit Schmerz auszutreiben […]“
(Franz Kafka, Briefe 1913 – 1914, Frankfurt/Main 1999)